Streuung
Die Farben des Himmels
Kontakt
English version
StreuungDie Farben des Himmels |
| Dietrich Zawischa Kontakt English version |
|
| In der Atmosphäre wird ein Teil des von der Sonne kommenden Lichts gestreut, d.h. in andere Richtungen abgelenkt. Von den kleinen Teilchen (Moleküle, winzige Wassertröpfchen und Staubteilchen) werden dabei die kurzwelligen Strahlen stärker gestreut als die langwelligen. Daher überwiegen im Streulicht die kurzwelligen Anteile, der Himmel erscheint blau, während das direkte Sonnenlicht gelblich ist, oder sogar rötlich, wenn die Sonne tief steht. Goethe glaubte hierin das Urphänomen der Farbentstehung zu sehen. |
|
| Durch die Streuung des Lichts an den Luftteilchen sieht man den Wald im Hintergrund wie hinter einem bläulichen Schleier ("Luft-Perspektive"). Ein bisschen Himmelblau ganz nahe. |
|
|
Das Farbenspiel von Sonnenauf- und -untergang überträgt sich sogar auf den Mond: Wenn bei einer Mondesfinsternis der Erdschatten den Mond verdunkelt, wird er durch das von der Erdatmosphäre in den Schattenbereich hinein gestreute Licht schwach beleuchtet. Dieses Licht ist überwiegend rötlich, da die kürzerwelligen Anteile größtenteils in andere Richtungen gestreut werden. Vom Mond aus wäre die Atmosphäre der Erde als leuchtender Lichtsaum zu sehen, der dort, wo keine Wolken sind, an der Innenseite rot ist und nach außen verblasst und bläulich wird. Partielle Mondesfinsternis vom 16. August 2008, fotografiert um 23:15 Uhr MESZ |
 | Himmelblau, ausgerechnet |
|
|
Untersuchen wir als nächstes ein kleines Tröpfchen,
das immer noch klein ist gegen die Wellenlängen des Lichts,
und aus N Molekülen Wasser besteht. Nehmen wir vereinfachend
(und nicht ganz korrekt) an, dass das elektrische Feld, das
jedes Teilchen spürt, gleich dem Feld der einfallenden
Welle ist, so wirkt das ganze Tröpfchen wie ein Molekül
mit einer N-fachen Polarisierbarkeit, und die gestreute
Welle ist von N2-facher Intensität. Solange das Tröpfchen
klein gegen die Lichtwellenlängen ist, wird wieder das
kurzwellige Licht viel stärker gestreut.
Größere TröpfchenMit zunehmender Tropfengröße verändert sich das Bild: die von den einzelnen Teilbereichen kommenden Streuwellen beginnen sich gegenseitig durch Interferenz auszulöschen; bei Abmessungen der Tröpfchen, die groß sind gegen die Wellenlängen, löschen sich die Streuwellen aus dem Inneren weitgehend aus, und was übrig bleibt, interpretieren wir summarisch als Reflexion und Brechung. Innerhalb des Volumens erfolgt praktisch keine Streuung mehr. Sind also die streuenden Teilchen größer als die Wellenlänge des Lichts (Nebel, Wolken), dann wird insgesamt mehr Licht gestreut und es sind alle Wellenlängen gleichermaßen betroffen – in diesem Fall spricht man von Mie-Streuung (Mie scattering). Die spektrale Zusammensetzung des Streulichtes hängt aber vom Streuwinkel ab. In dichten Wolken mittelt sich diese Winkelabhängigkeit durch verschiedene Tröpfchengrößen und durch Mehrfachstreuung heraus und die Wolken erscheinen weiß oder grau. Für ein ausgedehntes Medium, bei dem die Dichte praktisch konstant ist, heben sich die Streuwellen in allen Richtungen außer der Ausbreitungsrichtung des Lichtes weg. Eine homogene Flüssigkeit streut Licht also nicht, die Polarisierbarkeit der Teilchen führt nur auf eine Veränderung der Wellenlänge des Lichts im Medium; dies wird durch die Einführung eines Brechungsindex berücksichtigt. |
Der Tyndall-EffektStreuung tritt wieder auf, wenn in einem durchsichtigen Medium (in einer Flüssigkeit) kleine Teilchen abweichender Polarisierbarkeit suspendiert sind (Tyndall-Effekt). In Alkohol gelöster Mastix (ein Harz), Kolophonium oder auch z.B. Fichtenharz als Zusatz zu Wasser ergibt günstige Bedingungen zur Beobachtung des Effekts.Auch in diesem Fall ist die Größe der suspendierten Teilchen entscheidend: sind die Teilchen klein im Vergleich zu den Wellenlängen des Lichts, so sind Farberscheinungen zu beobachten, sind sie größer, so ist die Suspension einfach nur weißlich trüb. Das Bild rechts zeigt so eine Suspension von Fichtenharz in Wasser, von unten mit einem weißen Diodenlämpchen beleuchtet. Das transmittierte Licht fällt oben auf ein schräg über das Glas gehaltenes weißes Blatt Papier. |
|
| Der amorphe Opal besteht aus etwas wasserhaltigem Siliziumdioxid ("Kieselsäure"). Die Trübung (Opaleszenz) kommt durch die Wechsellagerung von verschieden stark wasserhaltigen Anteilen zustande, Wassereinschlüssen zwischen submikroskopisch kleinen Kieselsäurekügelchen, siehe die auf den Seiten von pinfire.de gezeigten REM-Aufnahmen. Tyndallstreuung an den Einschlüssen ist die Ursache dafür, dass der Stein im reflektierten Licht bläulich erscheint, im durchscheienden Licht gelblich. Durch die regelmäßige Anordnung der Streuzentren treten farbige Reflexe auf. Rechts ein Opal aus Äthiopien, Länge 22 mm | ||
|
Glas wird durch feinst verteilte, submikroskopisch kleine Kriställchen mit abweichendem Brechungsindex trübe, je nach Konzentration opalisierend oder milchig. Dies wird durch Zusatz von phosphorsaurem Kalk (Knochenasche), Zinnoxid oder Fluoriden (Kryolith, Na3Al F6) zur Glasschmelze erreicht. Kryolithglas (Opalglas, Bild rechts) erscheint vor einem dunklen Hintergrund himmelblau und im durchscheinenden Licht orangegelb. |
| |
| Lichtstreuung (der Tyndall-Effekt und die davon nicht wesentlich verschiedene
Rayleigh-Streuung) ist recht häufig zu beobachten.
Die blaue Augenfarbe ist wohl die bekannteste Farberscheinung aufgrund des Tyndall-Effekts (Bild rechts). Die Iris des menschlichen Auges enthält keinen blauen Farbstoff. Die optisch trübe vordere Schicht der Iris erscheint, wenn sie kein oder nur wenig Pigment (Melanin) enthält, vor der dunklen hinteren Schicht aufgrund der bevorzugten Streuung des kurzwelligen Lichtes blau. |
|
Wir haben die Rayleigh-Streuung für verdünnte Gase kennengelernt, da mussten die Intensitäten der einzelnen Streuwellen addiert werden. Bei Atmosphärendruck sind aber in einem würfelförmigen Volumen mit 400 nm Kantenlänge (entsprechend den kürzesten sichtbaren Wellenlängen) ca. 1,7 Millionen Moleküle enthalten. Sind die Bedingungen für unabhängige Streuung der einzelnen Teilchen noch erfüllt oder ist die Situation mehr die einer gleichförmigen Dichte, bei der die Streuwellen durch Interferenz verschwinden? Diese Frage wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Einstein und Smoluchowski untersucht, die fanden, dass Streuung an den Dichteschwankungen eines idealen Gases genau das gleiche Ergebnis liefert wie Streuung an den einzelnen, als unabhängig voneinander angesehenen Molekülen dieses Gases.
Selbstverständlich überlagern sich die von den einzelnem Teilchen gestreuten Wellen immer, und es tritt konstruktive und destruktive Interferenz auf. Aber wenn die Orte der einzelnen Teilchen völlig unabhängig voneinander sind, dann mitteln sich bei einer großen Zahl von Teilchen die Interferenzterme heraus, d.h. konstruktive und destruktive Interferenz halten sich die Waage, und die Intensität der Streuwellen ergibt sich als die Summe der Intensitäten von allen streuenden Teilchen.
Im Tierreich findet man zahlreiche Beispiele von nicht irisierenden (d.h. nicht vom Blickwinkel abhängigen), aber nicht durch Pigmente oder Farbstoffe erzeugten Blaufärbungen. Ursache ist jeweils eine Gewebeschicht mit kleinräumigen Dichteschwankungen (z.B. durch eingelagerte kleinste lichtstreuende Partikel) vor einer durch Melanin dunkel gefärbten Schicht. Das ist also sehr ähnlich wie beim Tyndall-Effekt, aber neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass das Spektrum des remittierten Lichtes nicht die bekannte Rayleigh-Tyndall-Form (umgekehrt proportional zur vierten Potenz der Wellenlänge) hat, weil die Streuzentren nicht völlig unregelmäßig angeordnet, sondern in ihren Abständen deutlich korreliert sind (Prum et al., 1999a, 1999b, 2004a, 2004b). Das Blau sei also eher den Strukturfarben zuzurechnen.

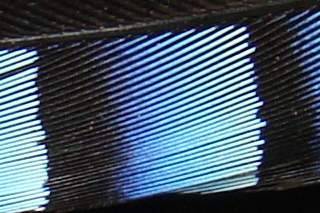
Beim Tyndalleffekt sind die streuenden Teilchen mit relativ geringer Dichte in einem größeren Volumen verteilt. Um in einer dünnen Schicht schon merkliche Streuung zu erzielen, muss die Dichte viel höher sein. Bei völlig regelloser Anordnung würden sich Klumpen bilden, daher wird ein gewisser Mindestabstand der Teilchen angestrebt. Dies führt zwar zu keiner langreichweitigen Ordnung, aber zu gleichmäßigerer Verteilung. Die folgenden Bilder sollen das veranschaulichen.
Linkes Bildpaar: ungeordnete, unkorrelierte Verteilung, rechts: statistische Verteilung mit festem Mindestabstand. Es sind stereoskopische Bildpaare, die die räumliche Tiefe zeigen, wenn man mit einem Auge auf das eine und dem anderen auf das andere Bild des Paares schaut.Ein kleiner kugelförmiger Bereich mit Radius 4 μm wird mit streuenden winzigen Teilchen gefüllt, die (a) statistisch verteilt sind oder (b) einen Mindestabstand von 200 nm haben müssen. Dann passen nur knapp 16000 Teilchen in die Kugel, daher wird auch im Fall (a) die Teilchenzahl auf diesen Wert beschränkt. Die Koordinaten werden in beiden Fällen durch einen Zufallszahlengenerator ermittelt. Die unter Vernachlässigung von Mehrfachstreuung berechneten Intensitäten zeigen starke statistische Schwankungen in ihrer Abhängigkeit von Streuwinkel und Wellenlänge. Um diese zu verringern, wird der Mittelwert über eine größere Anzahl gleichartiger Systeme gebildet. In den Diagrammen unten werden die Intensitäten für einen Streuwinkel von 120 Grad gezeigt, die mit der vierten Potenz der Wellenlänge multipliziert und in willkürlichen Einheiten aufgetragen sind.
Im Fall von Tyndallstreuung sollte für "unendlich viele Teilchen" die gezeigte Größe eine horizontale Linie ergeben. Es ist deutlich zu sehen, dass durch die den gewählten Mindestabstand die längerwelligen Anteile des Spektrums unterdrückt werden, wodurch die blaue Farbe vertieft wird. Diese Ergebnisse passen zu den experimentellen Befunden von Prum und Mitarbeitern.
Bei Strukturfarben, hervorgerufen durch Nanostrukturen wie Vielfachschichten (Käfer, Kolibris, Schmetterlinge) oder noch kompliziertere raumgitterartige Bildungen (Pfau, Fasane, Schmetterlinge), findet man das ganze Spektrum von bunten Farben realisiert. Die unregelmäßige Verteilung von "Nano-Streuzentren" liefert immer nur Nuancen in der Nähe von Himmelblau, insofern ist die Ähnlichkeit mit dem Tyndall-Effekt größer als die mit den anderen Strukturfarben.
Grünfärbung wird durch zusätzlichen gelben Farbstoff (meist ein Carotinoid) erreicht.
 Hyla arborea, Laubfrosch (Foto: Ineptus) | Die grüne Farbe von Amphibien und Reptilien kommt auf diese Weise zustande. Verschiedene Farbzellen sind in mehreren Schichten übereinander angeordnet: gelbe Xanthophoren weiter außen, darunter Guanophoren, in denen die farblose Substanz Guanin in kleinsten Kriställchen in der Zellflüssigkeit suspendiert ist, zuunterst eine durch Melanophoren dunkel gefärbte Schicht. (Siehe: "Nature's palette" von Margareta Wallin.) |
|
Zwei Papageien, Ara militaris, Soldatenara (Foto: RoFra, Lizenz CC BY 3.0) | Blaue und grüne Farben bei Vögeln kommen ebenfalls durch den "Tyndall-ähnlichen" Effekt zustande, sofern es keine Schillerfarben sind, siehe "Die Gefiederfarben der Vögel". Bei Papageienfedern wird in den vom Federschaft abgehenden Ästen durch Melanin schwarz gefärbtes Mark von großen Riesenzellen umgeben, in denen Melaninkörnchen in geringer Konzentration verteilt sind, die auch wieder das kurzwellige Licht stärker streuen als langwelliges und die daher vor dem schwarzen Mark blau erscheinen. Die äußerste Schicht der Äste besteht aus transparenten farblosen (blaue Federn) oder durch ein Carotinoid gelb gefärbten Zellen (grüne Federn). Die von den Ästen ausgehenden Strahlen sind farblos transparent oder durch Melanin dunkel gefärbt. |
Ischnura elegans (van der Linden) Große Pechlibelle, Männchen | Die blaue, aber nicht metallisch glänzende Farbe von Libellen entsteht auch so. Die Epidermiszellen unter der durchsichtigen Kutikula enthalten eine Suspension winzigster Partikel vor der durch Melanin schwarz gefärbten darunter liegenden Schicht (nach Sternberg & Buchwald (1999): Die Libellen Baden-Württembergs, Band 1. (© Ulmer Verlag, Stuttgart), siehe "Körperbau der Libellen"). |
Zurück zur Übersicht: Wie kommt Farbe zustande?
Weiter zur Besprechung von Beugungserscheinungen (unter anderem: irisierende Wolken)
Weiter zur Besprechung von Regenbögen und anderen atmosphärischen Farberscheinungen